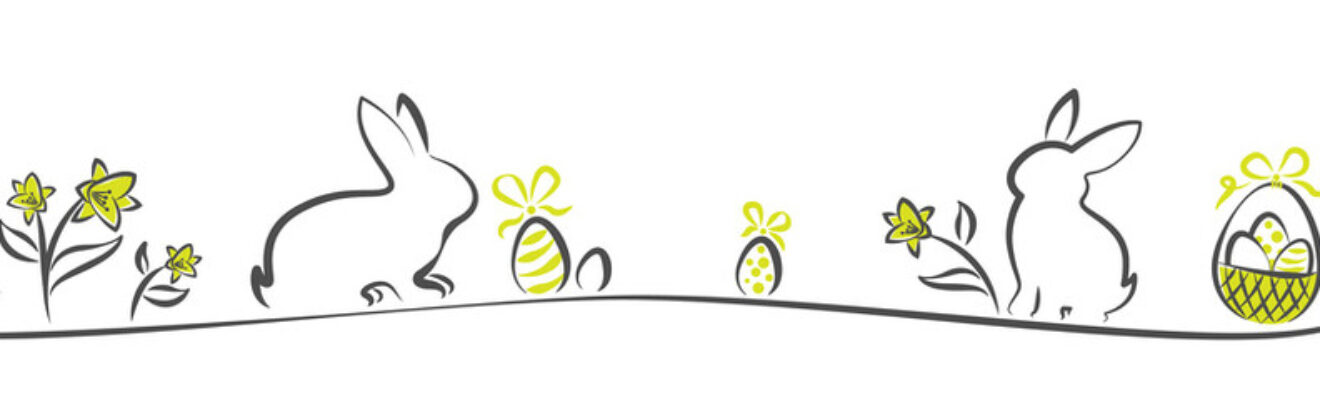Fünf Gründe, warum die Unfallversicherung die Organisation und Finanzierung der Pflege nicht übernehmen sollte!
Die ÖVP hat ihre Ideen zur Finanzierung der Pflege präsentiert. Zuständig soll die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) sein. Der ÖGB bringt fünf Gründe, warum das keine gute Idee ist.
1. AUVA-Kompetenz sind Unfälle, nicht Pflege
Die ÖVP will die Pflege neben Steuern auch aus den Mitteln der Unfallversicherung AUVA finanzieren. Diese soll dann auch organisatorisch zuständig sein. Keine gute Idee, sagt GPA-djp-Vorsitzende Barbara Teiber und spricht von „Themenverfehlung“: „Die AUVA ist hochgradig spezialisiert auf die Versorgung von Arbeitsunfällen, die Rehabilitation und die Prävention. Im Bereich Pflege besitzt die AUVA allerdings keine Kompetenz.“
2. Die AUVA hat mit Sicherheit nicht genug Geld, um die Pflege zu finanzieren
Die AUVA hat ein Budget von nicht einmal 1,5 Milliarden Euro, die Pflege kostet jährlich 5 Milliarden. Da geht sich was nicht aus! Stellt sich die Frage, woher der Rest kommen soll: Aus neuen Versicherungsbeiträgen, die die ArbeitnehmerInnen zahlen müssten, aus bisherigen Steuern, aus notwendigen, aber von der ÖVP immer abgelehnten Steuern auf große Vermögen – oder doch, wie vom Finanzminister der vorigen Bundesregierung mehrfach angedeutet, durch die Pflicht, sich bei privaten Versicherungskonzernen zu versichern?
3. AUVA-Pflegefinanzierung ändert nichts daran, dass nur der Faktor Arbeit einzahlt
Aus Sicht der ArbeitnehmerInnen hat die Finanzierung der Pflege aus den Mitteln der AUVA auf den ersten Blick einen Vorteil: nur die Arbeitgeber zahlen Beiträge in die AUVA ein. Aber auch, wenn ArbeitnehmerInnen keine Beiträge zahlen müssen, ändert sich nichts an der Tatsache, dass wieder einmal fast nur der Faktor Arbeit zur Finanzierung hinhalten müsste – wie auch schon bei Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung. Die riesigen Vermögen der Millionäre und deren Erben würden wieder einmal nicht angetastet. Vida-Vorsitzender Roman Hebenstreit: „In Österreich gibt es über 200.000 Dollarmillionäre. Tatsächlich ließe sich die Pflege mit einer Millionärssteuer viel einfacher finanzieren. Es würden dann endlich auch jene einen Beitrag zahlen, die es sich auch wirklich leisten können.“
4. Die AUVA braucht ihr Geld für andere Dinge: Prävention, Heilung, Rehabilitation
Die ÖVP sagt, die AUVA kann ruhig für die Pflege zahlen, denn die Arbeitsunfälle, um die sie sich heute kümmert, werden ohnehin immer weniger. Neue Herausforderungen in der Arbeitswelt bringen aber auch neue Aufgaben für die AUVA – und dafür braucht die AUVA Geld. Immer wichtiger werden die Erforschung und Vorbeugung arbeitsbedingter Erkrankungen. Dazu sollten neue Gesetze die AUVA verpflichten!
Die Berufskrankheitenliste muss dringend modernisiert werden! Denn eine Listung bedeutet: Die AUVA ist für Heilbehandlung, Prävention sowie Rehabilitation und Umschulung zuständig. Auch „Psychische Erkrankungen (insbes. Angststörungen und depressive Störungen)“ müssten in die Liste aufgenommen werden. Die Anzahl an Krankenstandstagen aufgrund von psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen hat sich seit Mitte der 90er Jahre verdreifacht. Darüber hinaus sind psychiatrische Erkrankungen seit Jahren die häufigste Ursache für Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension.
5. Auch Beschäftigte in der Pflege brauchen Ausweitung der Berufskrankheitenliste
Brigitte S. (51 Jahre) arbeitet seit 22 Jahren in einem Pflegeheim als Pflegehelferin. Sie hatte die letzten Jahre immer wieder Beschwerden mit dem Kreuz – kein Wunder, muss sie doch in ihrem Beruf immer wieder schwer heben und tragen. Vor vier Jahren allerdings sind die Schmerzen eskaliert, sie war wegen starker Rückenschmerzen und Bewegungsunfähigkeit in ärztlicher Behandlung. Die ÄrztInnen haben ihr geraten, den Beruf zu wechseln: Heben und Tragen sei für ihre Wirbelsäule das Schlechteste.
Leider wird ihre Erkrankung des Bewegungs- und Stützapparats nicht als Berufskrankheit durch die AUVA anerkannt. Das hätte viele Vorteile: Erstens müsste die AUVA eine umfassende qualitativ hochstehende Heilbehandlung und Rehabilitationsmaßnahmen (berufliche, soziale) zur Umschulung anbieten, dies würde z. B. auch eine Höherqualifizierung umfassen. Eine Erweiterung und Aktualisierung der Berufskrankheitenliste hätte weiters zur Folge, dass die AUVA die Präventionsaktivitäten in den Betrieben verstärkt.
Weiter lesen: Was gegen eine Pflegeversicherung spricht
(Information des ÖGB, 24.06.2019)